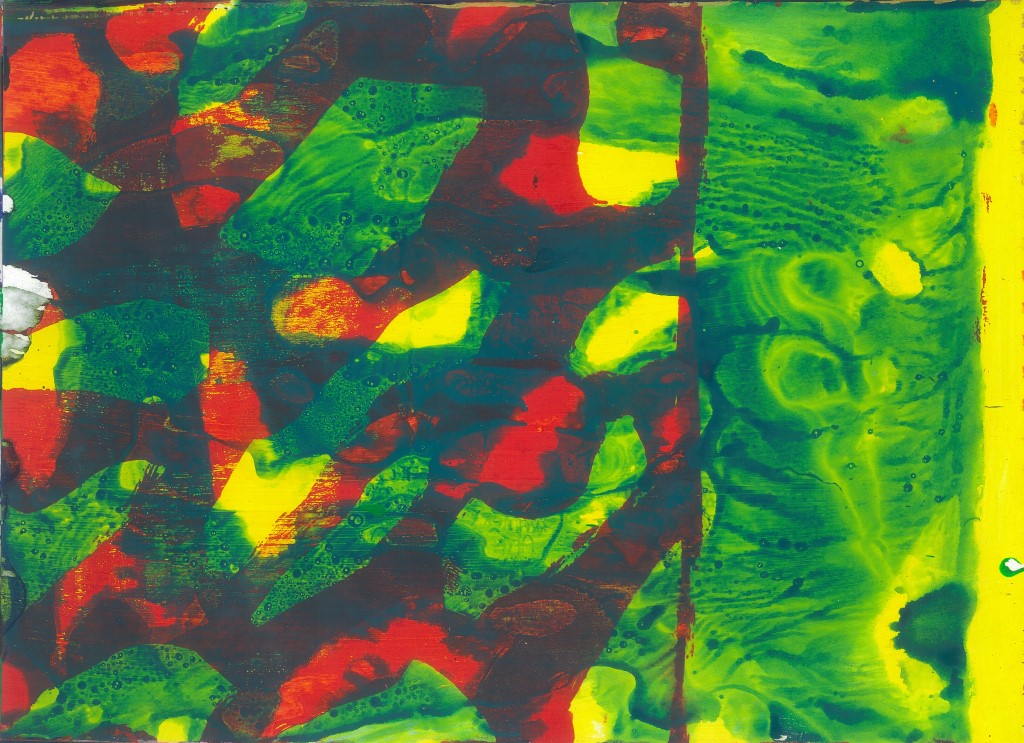Am Beginn des letzten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert mobilisierte Portugal Geld und Humanressourcen für die Umsetzung eines Sanierungsvorhabens im Osten Lissabons. Das frühere Industriegebiet an der Grenze zum Bezirk Loures sollte zunächst Schauplatz der 53. Weltausstellung [1] werden und anschließend ein „neuer“ Stadtteil. Auf 340 Hektar am Ufer des Tejo, wo sich im Laufe der Zeit Unordnung breit gemacht hatte, entstand nun nach normalisierten Erinnerungsnarrativen eine neue Ordnung. Die Expo 98 wurde zum Aushängeschild öffentlicher Bautätigkeit der 1990er-Jahre. Doch im Schatten des betörenden Glanzes dieses Kolosses der Stadtsanierung verschwinden Geschichten, die sich nie oder zumindest mangelhaft ins kollektive Gedächtnis geschrieben haben, wie die der Personen, die dort gearbeitet haben; wer und warum sie dort waren. Im „schmutzigsten, hässlichsten“ Teil der Stadt wurde ein Territorium neu belebt, mit bester Aussicht auf die Zukunft des Planeten und der Ozeane und für das sonntägliche Freizeitvergnügen.

Park der Nationen. @ Rui Sérgio Afonso 2021
Aus Trümmern zur Utopie. Vom Konsens zum schüchternen Widerspruch.
Trümmer und das, was aus ihnen entsteht, geben uns üblicher-weise Gelegenheit, einen Blick in den Lauf der Zeiten zu werfen und auf unser eigenes Verhältnis zur Vergangenheit, also das, was wir bewahren oder doch lieber „auslöschen“ wollen. Mit dem Entstehen eines sanierten Raums im Osten Lissabons wurde eine neue urbane Identität geschaffen für das, was wir heute als Park der Nationen (Parque das Nações
) kennen, mehr Insel als Halbinsel, mehr nach innen gerichtet als in der Lage, sich mit seiner Umgebung oder zu dem, was dort vorher war, in Beziehung zu setzen. Und doch war es mehr als Kosmetik, denn der Diskurs, der die Errichtung dieses Raums in der Stadt vor etwas mehr als zwanzig Jahren begleitete, war als (aus Sicht des Projekts) Zwischenzeit eingebunden in eine bestimmten Form der Erinnerungspolitik, wie sie damals üblich war, üblich ist und, wie ich zu prognostizieren wage, auch bleiben wird hierzulande. Wie immer liegt es an uns, etwas daran zu ändern. Und wie immer muss ein geeinter Wille dazu vorhanden sein.
Kürzlich, parallel zu den Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der Expo, mit Fotoausstellungen von vorher und nachher, hat die Journalistin Fernanda Câncio Personen eine Stimme gegeben, die diesen Bereich der Stadt noch vor dem Eingriff gekannt haben. Einer ihrer Gesprächspartner wies darauf hin, dass in manchen Stadtplänen von 1988 der gesamte Bereich zwischen
Santa Apolónia
und
Oriente
nicht einmal mehr aufgeführt war, als „gäbe es ihn gar nicht“; ein „Niemandsland [2]. Bruno Portela, der das Gebiet vor der Sanierung umfassend fotografiert und darüber ein Buch unter dem Titel „Uma cidade pode esconder outra
“ (Eine Stadt kann eine andere verstecken) veröffentlicht hat, gesteht ein, „dass es ein finsteres Gebiet war, eine Gegend im Schatten, in der Menschen wohl zu überleben wussten, es aber sonst keinen Grund gab, sich dorthin zu begeben außer für die Tätigkeiten, die dort vorherrschten“ [3], und er sieht auch das Unbehagen, das in diesen Betätigungszweigen steckt: Ein Schlachthof, Ölindustrie, Schrotthandel, Baracken und das Militärdepot
Beirolas
. Dazu der verseuchte Fluss
Trancão
.
Ironie der Geschichte, oder womöglich nicht einmal, ist, dass auf dem Areal des früheren Kriegswaffenlagers – für welchen Krieg eigentlich? Zu vermuten ist, dass es sich um den historisch nächstgelegenen, also den Kolonialkrieg handelt –, nun das entsteht, was der Essayist João Martins Pereira, einer der Wenigen, die gegen den damals herrschenden Konsens schrieben, als tosenden Vergangenheits- und Ahnenkult bezeichnet, durchtränkt von der Epopöe des vierzehnten Jahrhunderts [4] und einem utopischen Duktus, der uns bis in die Gegenwart verfolgt wie eine Sucht. Für einen Journalisten von damals entströmte den Flächen dort eine eigentümliche Poetik, doch die perfekte Metonymie des gesamten Vorgangs der Konversion und seiner leichtfüßigen historischen Tiefe verdichtet sich in dem Kommentar eines Internetnutzers zu Bruno Portelas Fotos, die nach 20 Jahren online gestellt wurden: „Es war eine sehr hässliche, traurige Gegend. Nun ist sie zivilisierter.“
Aus den Trümmern der Kriege werden eine adventistische Hoffnung errichtet und hohle Hyperbeln der Ozeane gezeichnet, im Zuge der Charmeoffensive zur Expo als Erbe der Zukunft und als das Versprechen auf mehr ökologisches Gleichgewicht verkauft. Letzteres aber vor allem dem Anlass geschuldet, eine Schimäre allein auf der Ebene der Utopie. Das Utopische, das sich nicht nur in dem nach ihr benannten Pavillon materialisierte – von innen als Bauch einer Karavelle der Eroberer, von außen als Raumschiff gestaltet –, der später umbenannt wurde zu Pavillon des Atlantiks, noch später Meo Arena und heute Altice-Arena, sondern schon am Anfang der Weltausstellung selbst stand. Im Kern die Idee von António Mega Ferreira und Vasco Graça Moura: die Feier von 500 Jahren portugiesischer Entdeckungen, der sagenumwobenen Reise von Vasco da Gama nach Indien. Das Utopische stand auch beim Bau des nach dem Seefahrer benannten Turms Pate, dem „höchsten Hochhaus Lissabons, 145 Meter hoch und imstande, Stürmen von mehr als 320 Stundenkilometern zu trotzen. Im Profil erinnert es an ein sich blähendes Segel in Anspielung an die unzähligen Schiffe, die über die Tejo-Mündung hinausfuhren, um die Welt zu entdecken.“ [5]. Das Hochhaus ist heute ein Luxushotel. Unter der Ägide der „Kostenneutralität“, die als Argument angeführt wurde, um Widerstände im Keim zu ersticken, wurden Infrastrukturen nach dem unschlagbaren Grundgedanken „großer öffentlicher Investitionen, großer privater Rendite“ geschaffen [6].

Park der Nationen. @ Rui Sérgio Afonso 2021
Die stolze und meist zügel- und konfliktlos die Zeit überdauernde Feier des Expansionismus ist symptomatisch für unser leidenschaftlich-fiktionales Verhältnis zur Vergangenheit. Die Widersprüche dieses Verhältnisses werden übersehen, versteckt und durch positives Denken ersetzt, das jede kritische Auseinandersetzung in den Hintergrund drängt. Damit werden schlechtes Gewissen und falsches Bewusstsein überlagert. Alles, was schlechtes Gewissen verursachen könnte, wird als lästig empfunden und verschämt verborgen oder, bevor es seine Geschichte erzählen kann, ganz zum Verschwinden gebracht: ein Rhinozeroshorn, das über einen Zwischenhändler auf dem Flohmarkt von Lissabon an ein paar Iren verkauft wird, die es zu Pulver vermahlen und schließlich in Asien verkaufen; ein geschnitzter Elefantenstoßzahn, dessen Wert im Zuge der hastigen und viel zu späten Dekolonisierung mit dem portugiesischen Wappen verblasst ist und keinen neuen Besitzer mehr findet. Im öffentlichen Raum allerdings kann Dinglichkeit weniger über die hier dargestellte Identität hinwegtäuschen, denn hier wurden Brücken und Stege errichtet für Helden und Abenteurer. Kulturen und Nationalitäten werden auf wenigen hundert Quadratmetern für je ein halbes Jahr zur Schau gestellt. Die Benennung der Straßen zollt historischen und literarischen Persönlichkeiten Tribut und verweist auf die Konstruktion eines Vorstellungsraums der Seefahrt (der zugleich kriegerisch ist, auch wenn diesen Teil letztlich das-selbe Schicksal ereilte wie das Kriegsgerätlager
Beirolas
: „Exil“), der mit Meer zu tun hat und mit Reisen und aus den Geschichten allein die Ikonen herausstellt und nicht ihre Taten, so wie es in den 1990er-Jahren noch immer gelehrt wurde. Ruhmreiche Könige, Infanten, Vizekönige orientalischer Niederlassungen neben Odysseus, Gulliver, Sandokan, Käpt’n Cook, Corto Maltese, nicht einmal das Gedicht Nau Catrineta wurde vergessen und wiederum zu Cousteau, Gago Coutinho, Roald Amundsen, Chen He und anderen Forschern gesellt, nach denen Wege, Passagen und
Avenidas
des Expo-Geländes benannt wurden. Eine Orgie des Literarischen, die schließlich in die
Via do Oriente
mündet, die anstatt nach dem Orient wohl besser als „Straße des Orientalismus“ benannt wäre. In unserem Land, in dem die Praxis des öffentlichen Diskurses um öffentliche Bauten stets zum Heroischen und Hyperbolischen neigt, wollen alle
Marquis de Pombal
sein oder Duarte Pacheco, denn wir haben uns daran gewöhnt, dass Geschichte die Namen der Architekten, Verwalter, Politiker und Persönlichkeiten im Auge behält und nur selten die von Personen wie Aboubacar und ihre Erinnerung.
Absturz der Utopie
Aboubacar lernte ich 2005 kennen, ein Einwanderer, der von sich behauptete, die Expo gebaut zu haben. Ich begegnete ihm, als er sich sozusagen in einer Abwärtsspirale befand, existenzielle Zweifel an ihm nagten und sich psychische Probleme in Gestalt von Verwirrtheit bemerkbar machten. Mir fielen seine Lederkappe auf und sein sanfter Blick an der Ecke der
Pastelaria Suíça
. Ich begegnete Aboubacar aus Zufall.
Damals war ständig von Ceuta und Melilla die Rede, von acht Meter hohen Grenzbefestigungen und von Personen aus Afrika, die versuchten, sie zu überwinden, von einer Invasion illegaler Einwanderer und davon, wie die marokkanische und spanische Polizei ihnen mit Schüssen begegneten. 2004 war die Europäische Grenzagentur Frontex gegründet worden und mit ihr nahm die Festung Europa Gestalt an. Es war wohl der Gipfel der Paranoia gegenüber der afrikanischen Einwanderung nach Europa, wobei auch schon in den 1990ern über Kontingente an illegalen Afrikanern fabuliert wurde, die insbesondere aus den ehemaligen Kolonien als „Horden nach Europa strömen“ würden. Die Tatsache, dass nur 3% der Migranten in Afrika den Kontinent tatsächlich verlassen, wird in diesem Diskurs nie berücksichtigt [7] und ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung. Der Hype um die Migration in den Jahren vor dem Bau der Expo ging darum, ob Portugal Einwanderungsland werden würde.
Die da kamen, waren zunächst „klandestin“, dann „illegal“. Sie lebten in dem, was die Journalisten als „Ghettos“ kategorisierten, Gemeinschaften, die als abgeschottet betrachtet wurden, weil man ihre Verbindungen ins Ausland nie angemessen berücksichtigte. Andererseits wurden in ihnen ethnische Rückzugsräume vermutet, die sie allein deswegen nie waren, weil sie als Provisorien angelegt waren, und nicht auf Dauer. Und trotz dieses deterministischen Blicks wurde angeprangert, dass von den Migranten dort „viele auf dem Bau arbeiten, dort aber wegen ihrer illegalen Situation von skrupellosen Unternehmern ausgebeutet werden“ [8]. Doch nicht darüber sprach Dias Loureira, der damalige Innenminister, als er mit weit utilitaristischerem Blick Portugals Recht beanspruchte, Migration „auszuwählen“, also nach eigener Interessenlage zu „gestatten“ [9]. Portugal entscheidet, sagte der Minister. Und Portugal entschied sich für zwei Legalisierungsinitiativen in den 1990er-Jahren als direkten Beitrag zu dem Jahrtausendwerk, das zum Jahrhundertende den Mythos Portugal feiern sollte.
Ich weiß nicht, ob es zutreffend ist oder nicht, da nicht alle Zeitangaben stimmig zueinander sind, aber Aboubacar behauptete, an der Expo gebaut zu haben. Er sagte dies voller Stolz. Er wird dort gearbeitet haben, irgendwann während seiner Zeit hier. 2005, als ich ihm begegnete, schlief er in der Obdachlosenunterkunft
Xabregas 1
, die er hasste, wie er mir erzählte, da er dort auf Konflikte stieß, denen er aus dem Weg gehen wollte. Er lebte ständig in Panik, dass ihm das Wenige, das ihm noch geblieben war, nachts gestohlen wurde. In der Unterkunft bekam er morgens Kaffee und eine warme Mahlzeit am Abend. Die übrige Zeit durfte man sich dort zwischen 9 und 18 Uhr nicht aufhalten. Also streifte er meist durch die Stadt. Auch
Xabregas
liegt im Osten Lissabons, nicht wahr? Aber
Xabregas
ist nicht neu gestrichen worden. Das Unkraut wuchert dort immer noch. Auch seit 2005 hat sich dort bis heute nur die Immobilienspekulation weiterentwickelt. Als Obdachloser ohne feste Bleibe und ohne Interesse, sich in der Notunterkunft aufzuhalten, um nicht bestohlen zu werden, entwickelte Aboubacar eine Art psychische Pathologie. Selbst das Erzählen der eigenen Geschichte fiel ihm schwer. Mit nur spärlichen, wirren Bestandteilen, voller Widersprüchen, charakteristisch für traumatisierte Erzählungen. Er sagte, er habe während der Expo auf dem Bau gearbeitet, habe in einem Haus mit vielen anderen Männern gelebt, die ebenfalls zum Arbeiten dort gewesen seien und ohne ihre Familien. 2004, als er seine Rechnungen nicht mehr habe bezahlen können, sagt er, habe man ihm eine Falle gestellt. Seine Papiere seien weggeschwemmt worden. Die Guineer, mit denen er zusammenlebte, hätten sich gegen ihn verschworen, und dann habe er auf der Straße gestanden. Auch die Arbeit am Bau habe ihn nicht mehr ernähren können nach dem damals einsetzenden wirtschaftlichen Niedergang, der in der Krise von 2008 mündete. Nun war er mit seiner Arbeitskraft nicht mehr erwünscht, sondern entbehrlich geworden.

Park der Nationen. @ Rui Sérgio Afonso 2021
Irgendwann gelang es ihm 2006 mit fremder Hilfe in das Rückführungsprogramm der Internationalen Organisation für Migration (IOM) aufgenommen zu werden, die ihm etwas Geld für den Neuanfang in seinem Herkunftsland zur Verfügung stellte. Ich hörte erst wieder von ihm, als ich im Senegal war, das muss 2011 gewesen sein. Inzwischen war er Französischlehrer, was er schon immer gewesen war, und wollte bald mit seinen mehr als vierzig Jahren eine junge Frau aus dem Dorf heiraten. Die verlorenen Jahre seines Lebens lassen sich auf einen Begriff bringen: Portugal. Das Land feierte 1998 seinen Ruhm als schicksalsreiche Nation und das verlorene Imperium in der historischen Kontinuität der Ausbeutung rassistisch entwerteter Arbeitskraft.
Aboubacars Leben ist nur eins von vielen, derer, die in den 1990er-Jahren als Arbeitskräfte mobilisiert wurden. Eins von vielen in Baustellenbaracken ausschließlich für Schwarze, die mit ansehen mussten, wie Kollegen von ihnen Hände, Arme und Leben verloren. Er ist einer von vielen, die nach Metern bezahlt wurden, als Anreiz, noch mehr zu schaffen, anstatt anständigen, nicht verschleiert berechneten Lohn zu bekommen. Einer von vielen, die sich der Unwürdigkeit unterziehen mussten, anstehen zu müssen, um aus einem Koffer den Lohn in bar ausbezahlt zu bekommen. Einer der vielen Migranten, die von Subunternehmern ausgebeutet wurden, die monatelang gar nicht zahlten, vertrösteten oder Geld unterschlugen und dabei wie Aufseher auf der Plantage agierten, Konflikte und Abgrenzung schürten, um die Vulnerabelsten abzusondern und deren Arbeitskraft noch mehr zu entwerten.
Aboubacar stammt aus Conakry, viele andere aber waren Angolaner, Guineer, Kapverdier, Senegalesen. Diese tausenden Männer, mit denen die Legalisierung des Aufenthalts begründet wurde [10], die Portugal eine weitere kärgliche Ruhmestat ermöglicht hatten, die Ausrichtung eines Ereignisses in der Dekadenz des portugiesischen Kolonialismus, mahnen uns, dass Utopie sich nicht aus Schimären errichten lässt, sondern mit Händen und Schweiß, und dass es keine Utopien gibt ohne Aufseher und entsprechend „entbehrliche“ Leben.
Erinnerungskultur
Heute freuen wir uns an diesem Raum, gehen leicht mit dem Fluss und der Landschaft um. Der baumbestandene Rasen am Ufer, der sich bis zur Brücke erstreckt, lädt ein zum Spazierengehen, die Promenade verleitet Sportler zum Joggen. Wir lassen uns vom Moment und von Freude einnehmen, denn nichts mehr erinnert daran, was in den Fundamenten ist. Auch der Blick verkauft sich gut in den neu entstandenen Wohngebieten, und die ganze Gegend steht ganz weit oben in der Liste der höchsten Quadratmeterpreise der Stadt. Der Pavillon in Gestalt eines Schiffsrumpfes ist Austragungsstätte von Großereignissen wie der weltweit „größten Technologiekonferenz“ (der Web Summit, mit der Portugals Regierung eine Langfristvereinbarung treffen konnte). Eine ganz neue Stadt ist entstanden …
Wie lässt sich aber in diesem Raum voll fast unantastbarer historischer Kanonisierung dem Beitrag einer beträchtlichen Zahl Afrikaner am Bau des Kolosses gedenken? Wie lässt sich die Erinnerung an solch unsichtbare Präsenzen bewahren? Wie lassen sich die anerkennen, die zum identitären Diskurs beitrugen – selbst aber nie daran teilhatten – der die Expo in die historische Kontinuität der letzten fünf Jahrhunderte portugiesischer Nation stellt? Wie gedenkt man der Diversität an einem Ort, an dem Kulturen in ihrer Gesamtheit verpackt wurden? Wie soll man an jene erinnern, die hartnäckig von der Politik ausgeschlossen werden zugunsten von Konzepten, Ideen, Utopie und Schimären? Wann treten ihre Erzählungen aus der Anonymität heraus? Mir bleiben nur Fragen. Die Antworten darauf müssen alle geben.